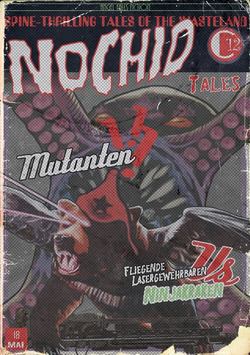|
Stargazer ist eine Geschichte aus dem Postapoc-Pulpgeschichten-Projekt NoCHID Tales und erschien mit zwei weiteren Geschichten in der Ausgabe Fliegende Lasergewehrbären VS Ninjakraken aus dem Weltall. Lust auf mehr davon? Let me know!
|
Stargazer
Eine beschissene Nacht.
Sobald die Sonne sich vom Himmel verkrochen hatte, wurde es auf der Einöde so kalt wie im Herzen einer unbezahlten Hure, und vom Wachposten aus sieht man in alle Richtungen nur gleichförmige Hügel aus Staub.
Der Wind treibt ihn hin und her, ohne dass er irgendwo hin wollte.
Der Wind hat verstanden. Er zieht unablässig, legt das eine Staubkorn hierher und das andere daher, und macht uns dabei die Ohren taub und die Augen blind, bis wir die Wüste nicht mehr ansehen müssen. Er erzählt von alter Zeit und ferner Zukunft, und in beiden ist alles genauso wie es immer war und sein wird. Vor einem Kampf trägt er uns den Gestank der Mutanten herbei und nachher begräbt er unsere Toten, während wir sie vergessen.
Es ist gerade Mitternacht, das heißt, ich werde noch einmal so lange in diesem leicht erhöhten Verschlag sitzen und in die Finsternis hinaussehen, auf der Suche nach Angreifern. Hoffen wir auf den Kampf, oder fürchten wir ihn? Ich weiß nur, dass ich ohne die Mutanten lange schon entweder der Lethargie oder dem Wahnsinn verfallen wäre. Ihre Angriffe bringen Struktur. Angst bringt Lebendigkeit. Erst den Tod zu sehen, lässt einen dem Leben etwas abgewinnen.
Wenn uns einer fragt, dann sagen wir, wir sind hier stationiert, um Angriffe auf die Stadt abzuwehren. Und dass die Städter uns dafür gebucht hätten. Dass wir stolz sind, diese Aufgabe zu erfüllen. Aber wer sind schon die Städter? Über die Hälfte der Frauen und Männer hier im Lager hat sich absichtlich versetzen lassen, weil sie es satt waren, in der Stadt mit Stardust, Alkohol und Schlägereien auf ihren Tod zu warten. Hier draußen holt er dich schneller ein.
Aber wir alle haben geschworen, es den Muties so schwer wie möglich zu machen. Die Armee macht dich leer, bevor sie dich gebrauchen kann, und füllt dich mit diesem einen Gedanken wieder voll: Nimm so viele mit, wie du kannst. Du wirst sowieso sterben. Jeder wird sterben. Bloß will keiner lange leiden. Und der Welt ist es egal, ob du mit fünfzehn, zwanzig, oder achtzig Jahren stirbst.
Darum war es für mich die Armee.
Und ich werde so viele Muties mitnehmen, wie ich kann. So lange ich einen Finger für den Abzug habe, werde ich nach ihnen schießen; und danach werde ich sie schlagen, bis sie meine Arme zwischen ihren Klauen zerfetzen; und wenn auch das nicht mehr geht werde ich beißen, bis ich an der Masse ihrer pervertierten Hirne ersticke.
Ich sitze im Wachposten, und nichts passiert.
Eine beschissene Nacht.
Es ist nach Mitternacht. Bald wird die Sonne wieder aufgehen und die eiskalte Wüste wieder in eine brennend heiße verwandeln. Da kommt eine Gestalt von den Hügeln her: ein einzelner schmaler Körper, aufrecht gehend, und nicht hastig, sondern eher wie ein Wanderer.
Wahrscheinlich ein Zivilist, auf dem Weg zur Stadt. Hat keinen Zutritt zum Lager.
Als die Gestalt näher kommt, erkenne ich mehr: eine Frau ist es, verhüllt in die typischen abgerissenen Fetzen, zu denen jede Kleidung verkommt, mit der man eine Reise durch dieses Ödland antritt. Sie tritt an den Posten, schlägt die Kapuze zurück und zieht das Mundtuch herab. Sie ist hoch gewachsen. Ich blicke aber trotzdem auf sie herunter, weil der Aussichtsposten, in dem ich sitze, erhöht gebaut ist.
Ich schaue auf eine Sonnenbrille und ein Gesicht von einer Schärfe, wie man es nur selten sieht. Brauen, Wangenknochen, Nasenflügel und Kiefer laufen in steilen Winkeln zueinander, was ihrem Gesicht den Eindruck eines flinken Tieres verleiht. Ihr schwarzes Haar ist kurz geschoren, unter der Sonnenbrille vermute ich schräge, große Augen, die ständig mal hier und mal dort hin blicken. Sie ist schlank, aber nicht ausgemergelt, und steht stolz und gerade vor mir.
Ich halte die Waffe schussbereit auf dem Schoß, durch die Bretter des Verschlags auf ihren Kopf gerichtet. Man kann ja nie wissen.
„Wie kann man dir weiterhelfen?“, sage ich, „Zivilisten haben im Lager keinen Zutritt.“
„Hab kein Interesse am Lager“, sagt sie.
Die Stimme ist rauh, wie immer bei Menschen, die über eine lange Zeit mehr Staub als Wasser in die Kehle bekamen.
„Sondern?“
„Schon mal die Sterne angesehen?“, fragt sie.
Die Sterne, denke ich. Warum sollte man die Sterne ansehen? Tausend Jahre altes Licht aus explodierenden Gaskugeln, oder auch: die Laternen aller möglichen Gottheiten, oder: die Seelen irgendwelcher lange toten Vorväter – was auch immer die Sterne in Wirklichkeit sind, nichts davon klingt nach etwas, was einen interessieren müsste.
Mir fällt auf, dass ich tatsächlich seit Jahren nicht mehr in der Nacht nach oben geschaut habe.
„Was willst du?“, frage ich.
Die Fremde legt den Kopf in den Nacken. Ihre Stimme klingt jetzt anders.
„Früher einmal haben die Menschen Reisen in den Himmel unternommen. Sind zum Mond geflogen, vielleicht auch noch weiter...
Vielleicht gibt es sogar immernoch welche da oben.“
Also eine von der Gaskugeln-Variante.
Ich frag sie: „Willst du mir jetzt erzählen, dass in Kürze jemand von da oben wiederkommen wird, und dann gibt’s Eiscreme für alle?“
Sie schaut mich an, verwundert: „Eiscreme?“
„Oder irgendwas. Alle Leute, die viel in den Himmel gucken, fangen irgendwann an, von sowas zu reden.“
„Von was?“
„Von Erlösern“, sage ich, „von höheren Wesen, der Zukunft...“
„Nein“, sagt sie. Dabei legt sie den Kopf schief, betrachtet mich, versucht mich einzuschätzen. Ich checke, ob die Waffe noch richtig ausgerichtet ist.
„Wenn's da jemanden gibt, dann glauben die nicht mehr an uns“, sagt sie. „Wir müssen hier unten schon selber klarkommen.“
Wohin führt dieses Gespräch eigentlich.
Entweder sie will ins Lager rein oder weiter zur Stadt – aber sie hätte ja auch einfach nach dem Weg fragen können. Oder sie versucht, mich abzulenken. Ich sehe mich nochmal um.
Niemand da. Keine heranstürmenden Mutanten, keine Räuber. Nur diese einzelne Wandrerin, und das mitten in der Nacht.
„Also, was willst du?“, frag ich sie. „Ich werd hier keinen Smalltalk mit dir führen, dafür bin ich nicht da. Dafür musst du in die Stadt weiter. Sind nur noch zwei Stunden Fußmarsch.“
„Ja, ich gehe in die Stadt“, sagt sie, „aber noch nicht. Ich habe Zeit.“
„Haben dir das die Sterne gesagt?“
Sie lächelt. „Gewissermaßen...“
Ich schaue mich noch einmal um und warte, dass sie weiter spricht. Wahrscheinlich hatte sie einfach nur einen Sonnenstich und ist jetzt in einem Wahnanfall nach dem Tag auch noch die ganze Nacht durchgewandert. Dann wird sie jetzt einfach immer weiter reden, würde dabei immer wirrer werden, und danach würde sie zusammenbrechen.
Woraufhin ich das melden würde, die Wache unten würde sie reinholen, und wenn sie Tauschware von Wert dabei hat, würden wir ihr auf dem nächsten Wagen in Richtung Stadt eine Passage verkaufen und sie dort den Schweizer Medics übergeben. Und wenn sie sich das nicht leisten kann, würden wir sie hier begraben.
Sie spricht weiter: „...im übertragenen Sinne. Man überlebt die Wüste nicht, wenn man nicht ab und an mal in den Sternenhimmel blickt. Nicht, dass er einem irgendetwas sagen würde... aber er ist ewig. Der Wind macht alles gleich hier unten. Wenn ihr hier weg seid, wird in einem Jahr keiner mehr sehen, dass hier mal ein Lager war. Wenn die Stadt weg ist, dauert es vielleicht dreißig oder hundert Jahre, aber auch sie wird im Staub verschwinden. Vielleicht gibt es hier genau unter uns die Reste einer anderen Stadt, wer weiß?
Der Staub regiert die Welt hier unten. Der Staub und der Wind. Und sie erlauben nicht, dass irgendetwas von Dauer ist...
Aber die Sterne bleiben.“
Ich schaue nach oben, blicke aber nur gegen das fleckige Sonnensegel des Wachpostens. Die Flecken sind aus Blut – wessen Blut, das weiß keiner mehr.
Ich stelle fest, dass ihr Gedanke so selbstverständlich durch meinen Geist fließt, als sei er mein eigener gewesen: Der Staub regiert. Aber den Sternen könne er nichts anhaben. Solche Gedanken kenne ich, es sind die aus der Nacht, die ich aber nie jemandem mitteile. Es sind Gedanken eines schlechten Soldaten: die Art von Gedanken, die einen Wachposten das Leben kosten können. Nicht umsonst steht Sentimentalität auf der Liste der Diagnosen eines unfähigen Soldaten direkt neben Illoyalität und Kampfstarre.
Die Fremde spricht weiter:
„Ich bin seit vier Wochen in der Wüste unterwegs. Natürlich will ich zur Stadt, aber ich hab gesehen, dass hier dieses Lager ist, und da wollte ich keine zwei weiteren Stunden mehr laufen, wo man doch auch hier mit jemandem sprechen kann...
Die Sterne mögen einen am Leben erhalten, aber einfach nur Überleben ist nicht genug, oder, findest du? Es braucht auch andere Wesen. Du gehst doch bestimmt auch immer mal in die Stadt oder zu den Huren.“
Dabei schaut sie schon wieder nach oben zu ihren Sternen.
Ich habe nur mein altes Sonnensegel. Ich kann keine Sterne sehen.
„Ich will nicht mehr alleine hochschauen“, sagt sie: „Du hast mich gefragt, was ich will. Ich will die Sterne nicht mehr für mich alleine haben. Ich will nicht die einzige sein, die so denkt.
Du, ich, wir alle werden einmal vergessen sein, und daran zu denken, macht mir fürchterliche Angst. Aber das wäre doch alles kein Problem, wenn zumindest in der Zeit, in der wir noch am Leben sind, jemand an uns denkt, oder? In dieser kurzen Zeit. Was danach ist, kann uns ja streng genommen sowieso egal sein.“
Ich schaue sie an. Schaue mich nicht mehr um. Die Nacht ist eh fast vorbei, und Angriffe kommen eher vor Mitternacht. Die Waffe auf meinem Schoß fühlt sich fremd an – ein totes Gewicht, dass ich gerade am liebsten einfach fallen lassen würde.
Sie fragt mich: „Hast du Angst?“
„Ohne Angst ist man ziemlich schnell tot. Aber die braucht einen nicht davon abzuhalten, das Richtige zu tun. Und Angst vor dem Staub ist Quatsch. Gegen den macht man ja eh nix.“
Sie nickt, und ihr schmaler Mund wird noch ein bisschen kleiner. Sie wirkt traurig.
„Aber ich verstehe, was du meinst“, sag ich hinterher. Und das ist wahr.
„Hast du Angst vor mir?“, fragt sie.
Ich weiß nichts über sie – sie könnte immernoch ein Lockvogel irgendeiner Räuberbande sein. Ja, ich sollte. Zumindest im Rahmen einer pflichtbewussten Vorsicht. Aber ich sage: „Nein.“ Und das ist auch wahr.
Sie schaut noch einmal in den Himmel, und dann sieht sie mich an – so scheint es zumindest, denn ihre Sonnenbrille trägt sie immernoch.
„Komm da runter.“, sagt sie. „Leg dich mit mir auf den Staub und schau in die Sterne.“
Nein. Das werde ich nicht tun. Du bist wahrscheinlich doch ein Lockvogel. Niemals werde ich das tun. Ich packe meine Waffe noch einmal, aber sie schmiegt sich nicht mit der Selbstverständlichkeit in meine Hand, mit der sie das sonst immer tut. Trotzdem: abfeuern werde ich sie können. Ich richte sie noch einmal auf ihren Kopf aus, und befehle der Fremden: „Brille abnehmen.“
Sie tritt einen Schritt an den Wachposten heran, in Point Blank-Reichweite. So nah, dass wir uns die Hände geben könnten. Dann hebt sie ihre beiden Hände, um zu zeigen, dass sie unbewaffnet ist, fasst an ihre Sonnenbrille, und nimmt sie herunter.
Meine Hand verkrampft sich um den Griff der Waffe.
Mein Gesicht erstarrt, und einen Moment habe ich nichts als Leere und Wind im Kopf – als ich wieder einen Gedanken fassen kann, ist es die Stimme meiner Kommandantin. Sie brüllt: Feuer! – Aber ich schieße nicht. Ich weiß, dass ich müsste, und immer wieder hallt mir der Befehl zu schießen durch den Kopf, aber ich schieße nicht. Ich hätte sofort schießen müssen, sobald sie die Sonnenbrille heruntergenommen hatte.
Die Fremde hat, um ehrlich zu sein, das schönste Gesicht, das ich seit Langem gesehen habe, mit zwei großen eleganten glänzenden Augen, genau dort, wo sie hingehören. Und mit Irissen, die wie bei einem Tier fast das ganze Auge ausfüllen, und die von oben nach unten durch schlitzförmige Pupillen in zwei geteilt werden. Katzenaugen. Darum hat sie auch von „Wesen“ gesprochen, während ich von „Menschen“ redete: weil sie kein Mensch ist. Sie ist eine Mutantin. Eine Deformation. Das, was ich geschworen habe, von der Erde zu tilgen.
Aber auch diese Augen, die einen Hohn auf die Menschheit darstellen, sind gerötet vom Staub, wie meine. Und sie schauen mich auf eine Weise an, wie kein Kamerad und keine Kameradin, kein Vorgesetzter und keine noch so teuere Hure mich jemals angesehen hat.
Sie weiß, dass ich sie töten muss.
Es liegt ein Flehen in ihrem Blick, das doch sein zu lassen.
Und stattdessen mit ihr zu kommen.
Und die Wahrheit ist, dass ich genau das auch will.
Ich könnte sie hier und jetzt erledigen. Ich müsste. Ich müsste ihr, mit einer einfachen Krümmung meines Fingers, eine Kugel zwischen diese Augen setzen, und ich hätte damit der Welt einen Gefallen getan.
Aber ich weiß, dass ich das nicht tun werde. Und, mal ehrlich: ist doch nicht so, dass irgendwann mal die Welt mir einen Gefallen getan hätte, oder?
Ich werde mit ihr gehen; und in die Sterne sehen so wie sie; und mich mit ihr in den Staub legen. Und wenn dann ihre hässlichen Cousins aus ihren Löchern kommen, sollen sie das tun. Und wenn sie das Lager unvorbereitet vorfinden. Eindringen. Und wenn sie es überrennen. Und die Stadt danach auch.
Und wenn sie selbst mir die Kehle zerschneidet, sobald ich aus meinem Posten raus bin und vor ihr auf dem Staub stehe – soll das alles doch geschehen.
Der Wind wird unsere Körper bedecken, und in ein paar Jahren wird es alles vergessen sein.
Sobald die Sonne sich vom Himmel verkrochen hatte, wurde es auf der Einöde so kalt wie im Herzen einer unbezahlten Hure, und vom Wachposten aus sieht man in alle Richtungen nur gleichförmige Hügel aus Staub.
Der Wind treibt ihn hin und her, ohne dass er irgendwo hin wollte.
Der Wind hat verstanden. Er zieht unablässig, legt das eine Staubkorn hierher und das andere daher, und macht uns dabei die Ohren taub und die Augen blind, bis wir die Wüste nicht mehr ansehen müssen. Er erzählt von alter Zeit und ferner Zukunft, und in beiden ist alles genauso wie es immer war und sein wird. Vor einem Kampf trägt er uns den Gestank der Mutanten herbei und nachher begräbt er unsere Toten, während wir sie vergessen.
Es ist gerade Mitternacht, das heißt, ich werde noch einmal so lange in diesem leicht erhöhten Verschlag sitzen und in die Finsternis hinaussehen, auf der Suche nach Angreifern. Hoffen wir auf den Kampf, oder fürchten wir ihn? Ich weiß nur, dass ich ohne die Mutanten lange schon entweder der Lethargie oder dem Wahnsinn verfallen wäre. Ihre Angriffe bringen Struktur. Angst bringt Lebendigkeit. Erst den Tod zu sehen, lässt einen dem Leben etwas abgewinnen.
Wenn uns einer fragt, dann sagen wir, wir sind hier stationiert, um Angriffe auf die Stadt abzuwehren. Und dass die Städter uns dafür gebucht hätten. Dass wir stolz sind, diese Aufgabe zu erfüllen. Aber wer sind schon die Städter? Über die Hälfte der Frauen und Männer hier im Lager hat sich absichtlich versetzen lassen, weil sie es satt waren, in der Stadt mit Stardust, Alkohol und Schlägereien auf ihren Tod zu warten. Hier draußen holt er dich schneller ein.
Aber wir alle haben geschworen, es den Muties so schwer wie möglich zu machen. Die Armee macht dich leer, bevor sie dich gebrauchen kann, und füllt dich mit diesem einen Gedanken wieder voll: Nimm so viele mit, wie du kannst. Du wirst sowieso sterben. Jeder wird sterben. Bloß will keiner lange leiden. Und der Welt ist es egal, ob du mit fünfzehn, zwanzig, oder achtzig Jahren stirbst.
Darum war es für mich die Armee.
Und ich werde so viele Muties mitnehmen, wie ich kann. So lange ich einen Finger für den Abzug habe, werde ich nach ihnen schießen; und danach werde ich sie schlagen, bis sie meine Arme zwischen ihren Klauen zerfetzen; und wenn auch das nicht mehr geht werde ich beißen, bis ich an der Masse ihrer pervertierten Hirne ersticke.
Ich sitze im Wachposten, und nichts passiert.
Eine beschissene Nacht.
Es ist nach Mitternacht. Bald wird die Sonne wieder aufgehen und die eiskalte Wüste wieder in eine brennend heiße verwandeln. Da kommt eine Gestalt von den Hügeln her: ein einzelner schmaler Körper, aufrecht gehend, und nicht hastig, sondern eher wie ein Wanderer.
Wahrscheinlich ein Zivilist, auf dem Weg zur Stadt. Hat keinen Zutritt zum Lager.
Als die Gestalt näher kommt, erkenne ich mehr: eine Frau ist es, verhüllt in die typischen abgerissenen Fetzen, zu denen jede Kleidung verkommt, mit der man eine Reise durch dieses Ödland antritt. Sie tritt an den Posten, schlägt die Kapuze zurück und zieht das Mundtuch herab. Sie ist hoch gewachsen. Ich blicke aber trotzdem auf sie herunter, weil der Aussichtsposten, in dem ich sitze, erhöht gebaut ist.
Ich schaue auf eine Sonnenbrille und ein Gesicht von einer Schärfe, wie man es nur selten sieht. Brauen, Wangenknochen, Nasenflügel und Kiefer laufen in steilen Winkeln zueinander, was ihrem Gesicht den Eindruck eines flinken Tieres verleiht. Ihr schwarzes Haar ist kurz geschoren, unter der Sonnenbrille vermute ich schräge, große Augen, die ständig mal hier und mal dort hin blicken. Sie ist schlank, aber nicht ausgemergelt, und steht stolz und gerade vor mir.
Ich halte die Waffe schussbereit auf dem Schoß, durch die Bretter des Verschlags auf ihren Kopf gerichtet. Man kann ja nie wissen.
„Wie kann man dir weiterhelfen?“, sage ich, „Zivilisten haben im Lager keinen Zutritt.“
„Hab kein Interesse am Lager“, sagt sie.
Die Stimme ist rauh, wie immer bei Menschen, die über eine lange Zeit mehr Staub als Wasser in die Kehle bekamen.
„Sondern?“
„Schon mal die Sterne angesehen?“, fragt sie.
Die Sterne, denke ich. Warum sollte man die Sterne ansehen? Tausend Jahre altes Licht aus explodierenden Gaskugeln, oder auch: die Laternen aller möglichen Gottheiten, oder: die Seelen irgendwelcher lange toten Vorväter – was auch immer die Sterne in Wirklichkeit sind, nichts davon klingt nach etwas, was einen interessieren müsste.
Mir fällt auf, dass ich tatsächlich seit Jahren nicht mehr in der Nacht nach oben geschaut habe.
„Was willst du?“, frage ich.
Die Fremde legt den Kopf in den Nacken. Ihre Stimme klingt jetzt anders.
„Früher einmal haben die Menschen Reisen in den Himmel unternommen. Sind zum Mond geflogen, vielleicht auch noch weiter...
Vielleicht gibt es sogar immernoch welche da oben.“
Also eine von der Gaskugeln-Variante.
Ich frag sie: „Willst du mir jetzt erzählen, dass in Kürze jemand von da oben wiederkommen wird, und dann gibt’s Eiscreme für alle?“
Sie schaut mich an, verwundert: „Eiscreme?“
„Oder irgendwas. Alle Leute, die viel in den Himmel gucken, fangen irgendwann an, von sowas zu reden.“
„Von was?“
„Von Erlösern“, sage ich, „von höheren Wesen, der Zukunft...“
„Nein“, sagt sie. Dabei legt sie den Kopf schief, betrachtet mich, versucht mich einzuschätzen. Ich checke, ob die Waffe noch richtig ausgerichtet ist.
„Wenn's da jemanden gibt, dann glauben die nicht mehr an uns“, sagt sie. „Wir müssen hier unten schon selber klarkommen.“
Wohin führt dieses Gespräch eigentlich.
Entweder sie will ins Lager rein oder weiter zur Stadt – aber sie hätte ja auch einfach nach dem Weg fragen können. Oder sie versucht, mich abzulenken. Ich sehe mich nochmal um.
Niemand da. Keine heranstürmenden Mutanten, keine Räuber. Nur diese einzelne Wandrerin, und das mitten in der Nacht.
„Also, was willst du?“, frag ich sie. „Ich werd hier keinen Smalltalk mit dir führen, dafür bin ich nicht da. Dafür musst du in die Stadt weiter. Sind nur noch zwei Stunden Fußmarsch.“
„Ja, ich gehe in die Stadt“, sagt sie, „aber noch nicht. Ich habe Zeit.“
„Haben dir das die Sterne gesagt?“
Sie lächelt. „Gewissermaßen...“
Ich schaue mich noch einmal um und warte, dass sie weiter spricht. Wahrscheinlich hatte sie einfach nur einen Sonnenstich und ist jetzt in einem Wahnanfall nach dem Tag auch noch die ganze Nacht durchgewandert. Dann wird sie jetzt einfach immer weiter reden, würde dabei immer wirrer werden, und danach würde sie zusammenbrechen.
Woraufhin ich das melden würde, die Wache unten würde sie reinholen, und wenn sie Tauschware von Wert dabei hat, würden wir ihr auf dem nächsten Wagen in Richtung Stadt eine Passage verkaufen und sie dort den Schweizer Medics übergeben. Und wenn sie sich das nicht leisten kann, würden wir sie hier begraben.
Sie spricht weiter: „...im übertragenen Sinne. Man überlebt die Wüste nicht, wenn man nicht ab und an mal in den Sternenhimmel blickt. Nicht, dass er einem irgendetwas sagen würde... aber er ist ewig. Der Wind macht alles gleich hier unten. Wenn ihr hier weg seid, wird in einem Jahr keiner mehr sehen, dass hier mal ein Lager war. Wenn die Stadt weg ist, dauert es vielleicht dreißig oder hundert Jahre, aber auch sie wird im Staub verschwinden. Vielleicht gibt es hier genau unter uns die Reste einer anderen Stadt, wer weiß?
Der Staub regiert die Welt hier unten. Der Staub und der Wind. Und sie erlauben nicht, dass irgendetwas von Dauer ist...
Aber die Sterne bleiben.“
Ich schaue nach oben, blicke aber nur gegen das fleckige Sonnensegel des Wachpostens. Die Flecken sind aus Blut – wessen Blut, das weiß keiner mehr.
Ich stelle fest, dass ihr Gedanke so selbstverständlich durch meinen Geist fließt, als sei er mein eigener gewesen: Der Staub regiert. Aber den Sternen könne er nichts anhaben. Solche Gedanken kenne ich, es sind die aus der Nacht, die ich aber nie jemandem mitteile. Es sind Gedanken eines schlechten Soldaten: die Art von Gedanken, die einen Wachposten das Leben kosten können. Nicht umsonst steht Sentimentalität auf der Liste der Diagnosen eines unfähigen Soldaten direkt neben Illoyalität und Kampfstarre.
Die Fremde spricht weiter:
„Ich bin seit vier Wochen in der Wüste unterwegs. Natürlich will ich zur Stadt, aber ich hab gesehen, dass hier dieses Lager ist, und da wollte ich keine zwei weiteren Stunden mehr laufen, wo man doch auch hier mit jemandem sprechen kann...
Die Sterne mögen einen am Leben erhalten, aber einfach nur Überleben ist nicht genug, oder, findest du? Es braucht auch andere Wesen. Du gehst doch bestimmt auch immer mal in die Stadt oder zu den Huren.“
Dabei schaut sie schon wieder nach oben zu ihren Sternen.
Ich habe nur mein altes Sonnensegel. Ich kann keine Sterne sehen.
„Ich will nicht mehr alleine hochschauen“, sagt sie: „Du hast mich gefragt, was ich will. Ich will die Sterne nicht mehr für mich alleine haben. Ich will nicht die einzige sein, die so denkt.
Du, ich, wir alle werden einmal vergessen sein, und daran zu denken, macht mir fürchterliche Angst. Aber das wäre doch alles kein Problem, wenn zumindest in der Zeit, in der wir noch am Leben sind, jemand an uns denkt, oder? In dieser kurzen Zeit. Was danach ist, kann uns ja streng genommen sowieso egal sein.“
Ich schaue sie an. Schaue mich nicht mehr um. Die Nacht ist eh fast vorbei, und Angriffe kommen eher vor Mitternacht. Die Waffe auf meinem Schoß fühlt sich fremd an – ein totes Gewicht, dass ich gerade am liebsten einfach fallen lassen würde.
Sie fragt mich: „Hast du Angst?“
„Ohne Angst ist man ziemlich schnell tot. Aber die braucht einen nicht davon abzuhalten, das Richtige zu tun. Und Angst vor dem Staub ist Quatsch. Gegen den macht man ja eh nix.“
Sie nickt, und ihr schmaler Mund wird noch ein bisschen kleiner. Sie wirkt traurig.
„Aber ich verstehe, was du meinst“, sag ich hinterher. Und das ist wahr.
„Hast du Angst vor mir?“, fragt sie.
Ich weiß nichts über sie – sie könnte immernoch ein Lockvogel irgendeiner Räuberbande sein. Ja, ich sollte. Zumindest im Rahmen einer pflichtbewussten Vorsicht. Aber ich sage: „Nein.“ Und das ist auch wahr.
Sie schaut noch einmal in den Himmel, und dann sieht sie mich an – so scheint es zumindest, denn ihre Sonnenbrille trägt sie immernoch.
„Komm da runter.“, sagt sie. „Leg dich mit mir auf den Staub und schau in die Sterne.“
Nein. Das werde ich nicht tun. Du bist wahrscheinlich doch ein Lockvogel. Niemals werde ich das tun. Ich packe meine Waffe noch einmal, aber sie schmiegt sich nicht mit der Selbstverständlichkeit in meine Hand, mit der sie das sonst immer tut. Trotzdem: abfeuern werde ich sie können. Ich richte sie noch einmal auf ihren Kopf aus, und befehle der Fremden: „Brille abnehmen.“
Sie tritt einen Schritt an den Wachposten heran, in Point Blank-Reichweite. So nah, dass wir uns die Hände geben könnten. Dann hebt sie ihre beiden Hände, um zu zeigen, dass sie unbewaffnet ist, fasst an ihre Sonnenbrille, und nimmt sie herunter.
Meine Hand verkrampft sich um den Griff der Waffe.
Mein Gesicht erstarrt, und einen Moment habe ich nichts als Leere und Wind im Kopf – als ich wieder einen Gedanken fassen kann, ist es die Stimme meiner Kommandantin. Sie brüllt: Feuer! – Aber ich schieße nicht. Ich weiß, dass ich müsste, und immer wieder hallt mir der Befehl zu schießen durch den Kopf, aber ich schieße nicht. Ich hätte sofort schießen müssen, sobald sie die Sonnenbrille heruntergenommen hatte.
Die Fremde hat, um ehrlich zu sein, das schönste Gesicht, das ich seit Langem gesehen habe, mit zwei großen eleganten glänzenden Augen, genau dort, wo sie hingehören. Und mit Irissen, die wie bei einem Tier fast das ganze Auge ausfüllen, und die von oben nach unten durch schlitzförmige Pupillen in zwei geteilt werden. Katzenaugen. Darum hat sie auch von „Wesen“ gesprochen, während ich von „Menschen“ redete: weil sie kein Mensch ist. Sie ist eine Mutantin. Eine Deformation. Das, was ich geschworen habe, von der Erde zu tilgen.
Aber auch diese Augen, die einen Hohn auf die Menschheit darstellen, sind gerötet vom Staub, wie meine. Und sie schauen mich auf eine Weise an, wie kein Kamerad und keine Kameradin, kein Vorgesetzter und keine noch so teuere Hure mich jemals angesehen hat.
Sie weiß, dass ich sie töten muss.
Es liegt ein Flehen in ihrem Blick, das doch sein zu lassen.
Und stattdessen mit ihr zu kommen.
Und die Wahrheit ist, dass ich genau das auch will.
Ich könnte sie hier und jetzt erledigen. Ich müsste. Ich müsste ihr, mit einer einfachen Krümmung meines Fingers, eine Kugel zwischen diese Augen setzen, und ich hätte damit der Welt einen Gefallen getan.
Aber ich weiß, dass ich das nicht tun werde. Und, mal ehrlich: ist doch nicht so, dass irgendwann mal die Welt mir einen Gefallen getan hätte, oder?
Ich werde mit ihr gehen; und in die Sterne sehen so wie sie; und mich mit ihr in den Staub legen. Und wenn dann ihre hässlichen Cousins aus ihren Löchern kommen, sollen sie das tun. Und wenn sie das Lager unvorbereitet vorfinden. Eindringen. Und wenn sie es überrennen. Und die Stadt danach auch.
Und wenn sie selbst mir die Kehle zerschneidet, sobald ich aus meinem Posten raus bin und vor ihr auf dem Staub stehe – soll das alles doch geschehen.
Der Wind wird unsere Körper bedecken, und in ein paar Jahren wird es alles vergessen sein.